Implementierung als Testorakel
Autonome Fahrfunktionen und sicherheitskritische Systeme müssen in der Automobilindustrie gut getestet sein. Besonders effizient geht die...

Die Rolle der Informatiker könnte sich verändern, da autonome Systeme an Bedeutung gewinnen. Diese Systeme benötigen ein hohes Maß an Intelligenz und sollen in der Lage sein, selbstständig zu operieren und Entscheidungen zu treffen, um Herausforderungen, wie etwa in der Energiewende oder der industriellen Fertigung, zu bewältigen. Eine neue Disziplin könnte die "Autonomik" sein, die verschiedene technische Bereiche vereinen und eine wichtige Grundlage für die Sicherstellung der Qualität in autonomen Systemen bieten könnte.
In dieser Episode spreche ich mit Prof. Peter Liggesmeyer über die Zukunft der Softwarequalität und die Entwicklung autonomer Systeme. Wir diskutieren, ob die Informatik für die kommenden Herausforderungen ausreichend ist oder ob neue Fähigkeiten und Disziplinen notwendig werden. Prof. Liggesmeyer bringt spannende Perspektiven ein, einschließlich des Begriffs "Autonomik" - eine Disziplin, die sich mit der Gestaltung autonomer Systeme beschäftigt. Er erklärt, wie diese Systeme in Bereichen wie Industrie 4.0 und der Energiewende eine immer wichtigere Rolle spielen werden.
"Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren die Gründung einer neuen Disziplin sehen werden. Ich würde die gerne in Anlehnung an die Informatik als Autonomik bezeichnen." - Peter Liggesmeyer
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Liggesmeyer ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern und Inhaber des Lehrstuhls für Software Engineering am Fachbereich Informatik der RPTU Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Von 2014 bis 2017 leitete er die Geschicke der Gesellschaft für Informatik (GI e.V.) als deren Präsident. Er ist wissenschaftlicher Sprecher des »Forschungsbeirats Industrie 4.0«. 2022 wurde er als Fachvertreter Mathematik/Informatik in den Vorstandsrat der »Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte GDNÄ« gewählt. Der »Feldafinger Kreis« nahm ihn 2022 als Mitglied auf. Für seine Forschungsarbeiten erhielt er 2023 den »Deutschen Preis für Software-Qualität«.
Autonome Systeme sind ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Technologie, die bereits in vielen Bereichen der modernen Welt Anwendung finden. In diesem Artikel werden wir folgende Themen behandeln:
Autonome Systeme haben das Potenzial, verschiedene Branchen zu verändern und neue Möglichkeiten für Innovation zu schaffen. Lassen Sie uns in die Welt der Autonomik eintauchen und herausfinden, was diese Zukunftstechnologie so spannend macht.
Autonomik ist eine vielversprechende Disziplin, die verschiedene Fachbereiche miteinander verbindet, um die Entwicklung autonomer Systeme voranzutreiben. Besonders wichtig für den Erfolg sind die Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau:
Informatiker spielen eine Schlüsselrolle bei der Programmatik und Softwareentwicklung autonomer Systeme. Sie gewährleisten die reibungslose Funktionalität und Interaktion der Systeme.
Elektroingenieure sind essentiell für die Hardwarekomponenten autonomer Systeme. Sie sorgen dafür, dass die technologische Basis optimal funktioniert und den Anforderungen entspricht.
Der Maschinenbau bringt sein Know-how in die Konstruktion physischer Strukturen autonomer Systeme ein. Diese müssen präzise geplant und realisiert werden, um die Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
Eine interdisziplinäre Ausbildung ist für angehende Experten auf dem Gebiet der Autonomik unerlässlich. Durch das Verständnis und die Zusammenarbeit dieser Fachbereiche können innovative Lösungen entwickelt werden, die den Anforderungen der modernen Welt gerecht werden.
Die Entwicklung autonomer Systeme setzt ein tiefgehendes Verständnis verschiedener technischer Grundlagen voraus. Informatiker im Bereich der Autonomik benötigen insbesondere Kenntnisse in den Hardwaregrundlagen, um die Schnittstellen zwischen Software und physischer Umgebung sicher zu gestalten. Ein fundiertes Wissen über Mikroelektronik ist zwar hilfreich, jedoch nicht zwingend erforderlich, da sich die Disziplin auf die Integration und Anwendung konzentriert.
Mathematische Modellierung spielt eine zentrale Rolle bei der Realisierung autonomer Systeme. Sie ermöglicht es, komplexe Regelungs- und Steuerungsalgorithmen zu entwickeln, die das Verhalten der Systeme präzise vorhersagen und anpassen können. Komplexe mathematische Methoden sind dabei oft Teil der Forschung, während praktische Anwendungen eher auf verständliche Modelle setzen.
Herausforderungen ergeben sich durch die hohe Komplexität autonomer Systeme, die verschiedene Ebenen von Hardware und Software umfassen. Die sichere Interaktion mit der Umwelt verlangt kontinuierliche Anpassungen und Optimierungen – sowohl während der Entwicklung als auch im laufenden Betrieb. Hierbei spielen KI und Testautomatisierung eine entscheidende Rolle, da sie helfen, diese Anpassungen effizient umzusetzen.
Ein weiterer Aspekt ist das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Verfügbarkeit. Autonome Systeme müssen zuverlässig funktionieren, auch wenn sie gleichzeitig flexibel auf neue Situationen reagieren sollen. Diese Anforderungen führen zu einem Spannungsfeld, in dem sorgfältige Kompromisse gefunden werden müssen, um Funktionalität, Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
Um solche Herausforderungen erfolgreich zu meistern, könnte Agilität eine passende Antwort bieten. Agilität bietet einen Rahmen, um Herausforderungen der Zukunft kreativ zu bewältigen und sowohl persönliche als auch teamorientierte Entwicklung zu fördern.
Zusätzlich ist es wichtig, Verantwortung für die Technologieübernahme zu übernehmen und sie als Werkzeug zu nutzen, um gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Dies wird in dem Artikel "Wer ist hier der Chef?" weiter erläutert.
Autonome Systeme eröffnen vielfältige Potenziale, die das Zeitalter der Autonomik maßgeblich prägen.
Die Sicherheit autonomer Systeme stellt eine zentrale Herausforderung dar. Risiken ergeben sich insbesondere aus der Komplexität der Systeme und möglichen Fehlfunktionen.
Das Zusammenspiel von Chancen und Risiken verlangt eine ausgewogene Herangehensweise, bei der Innovation mit Sorgfalt verbunden wird, um das volle Potenzial autonomer Technologien verantwortungsvoll auszuschöpfen.
Die Verschmelzung von Mass-Customization und Industrie 4.0 stellt einen wesentlichen Fortschritt in der Fertigung dar. Mass-Customization kombiniert die Vorteile der Massenproduktion mit der Möglichkeit, Produkte individuell anzupassen. Industrie 4.0-Technologien ermöglichen diese Verbindung durch intelligente Vernetzung und autonome Systeme, die flexibel auf Kundenwünsche eingehen können.
Industrie 4.0 basiert auf einem Netzwerk von cyber-physischen Systemen, die Daten in Echtzeit austauschen und verarbeiten. Dieses intelligente Zusammenspiel erlaubt es, Produktionsprozesse dynamisch an individuelle Anforderungen anzupassen ohne Einbußen bei Effizienz oder Qualität hinzunehmen. Autonome Systeme übernehmen dabei Aufgaben wie Steuerung, Überwachung und Optimierung der Fertigung.
Beispiele für maßgeschneiderte Produkte, die durch autonome Systeme effizient hergestellt werden, zeigen sich in verschiedenen Branchen:
Diese Entwicklungen eröffnen neue Möglichkeiten für Unternehmen, kundenorientierte Produkte in großer Stückzahl zu fertigen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Autonome Systeme bilden das Rückgrat dieser Transformation, indem sie Komplexität beherrschen und individuelle Anpassungen in den Massenproduktionsprozess integrieren.
Ein wichtiger Aspekt dieser Transformation ist die Rolle des Software-Testings. Laut den neuesten Software-Testing-Trends, gestalten KI und agile Ansätze die Zukunft des Testens erheblich. Diese Trends werden auch in der Testorganisation des nächsten Jahrzehnts sichtbar, wo KI und neue Modelle die Branche prägen und einen größeren Einfluss auf die Rollenverteilung zwischen Mensch und Maschine haben werden.
Autonome Systeme ermöglichen eine signifikante Kostenreduktion bei der Automatisierung, da sie Prozesse nicht nur automatisieren, sondern auch die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Systeme kontinuierlich gewährleisten. Unternehmen profitieren von einer intelligenten Fabrik, in der Abläufe selbstständig gesteuert und optimiert werden. Die Automatisierung reduziert manuelle Eingriffe und minimiert Fehlerquellen, was zu effizienteren Produktionsprozessen führt.
Die Qualitätssicherung autonomer Systeme stellt eine besondere Herausforderung dar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen erfordern autonome Anlagen eine dynamische Überwachung während des laufenden Betriebs, um auf Veränderungen in Echtzeit reagieren zu können. Dieses Qualitätsmanagement in Echtzeit stellt sicher, dass Sicherheits- und Funktionsanforderungen auch unter variablen Bedingungen eingehalten werden.
Ein zentraler Aspekt sind die Optimierungskompromisse, die bei der Entwicklung autonomer Systeme eingegangen werden müssen. Beispielsweise kann eine Erhöhung der Sicherheit zu Lasten der Verfügbarkeit gehen. Solche Zielkonflikte erfordern intelligente Lösungen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen verschiedenen Systemeigenschaften schaffen. Autonome Fabriken nutzen hierfür fortschrittliche Algorithmen, um optimale Betriebszustände zu ermitteln und anzupassen.
Die Fähigkeit autonomer Systeme, sich selbst ein gültiges Abbild ihrer eigenen Zustände zu verschaffen, ist entscheidend für die Vorhersage sicherer Betriebsbedingungen während Anpassungen oder Störungen. Dadurch wird eine kontinuierliche Systemverfügbarkeit neben hoher Sicherheitsstandards gewährleistet – eine Grundvoraussetzung für den Erfolg intelligenter Fabriken in Industrie 4.0-Umgebungen.
In dieser Zukunft des Testens wird es erforderlich sein, Soft-Skills und Automatisierung miteinander zu kombinieren, um den steigenden Anforderungen in einer KI-dominierten Welt gerecht zu werden.
Autonome Systeme operieren eigenständig und müssen ständig auf Sicherheit geprüft werden. Kontinuierliche Zertifizierung gewährleistet, dass die Systeme den geforderten Standards entsprechen. Risiken wie Datenmanipulation oder Ausfälle können so frühzeitig erkannt und behoben werden.
Agile Entwicklung ermöglicht schnelle Anpassungen an neue Anforderungen und sich verändernde Bedrohungen. Durch regelmäßiges Feedback können Nutzerbedürfnisse besser erfasst und umgesetzt werden. Transparente Prozesse und offene Kommunikation tragen zur Akzeptanz und Vertrauensbildung bei.
Studiengänge Autonomik adressieren die steigende Nachfrage nach Fachkräften, die komplexe autonome Systeme gestalten und entwickeln können. Die Curricula dieser innovativen Ausbildungsprogramme sind gezielt auf die Bedürfnisse des modernen Arbeitsmarktes ausgerichtet.
Wichtige Bestandteile umfassen:
Der Fokus liegt darauf, angehende Experten nicht nur in technischen Grundlagen auszubilden, sondern auch auf die dynamischen Herausforderungen autonomer Systeme vorzubereiten. So entstehen Spezialisten, die sowohl algorithmisch versiert als auch systemisch denkend agieren können.
Die Integration von KI und Data Science in den Studiengang Autonomik bildet das Fundament für eine zukunftsfähige Qualifikation in diesem wachsenden Technologiefeld.

Autonome Fahrfunktionen und sicherheitskritische Systeme müssen in der Automobilindustrie gut getestet sein. Besonders effizient geht die...
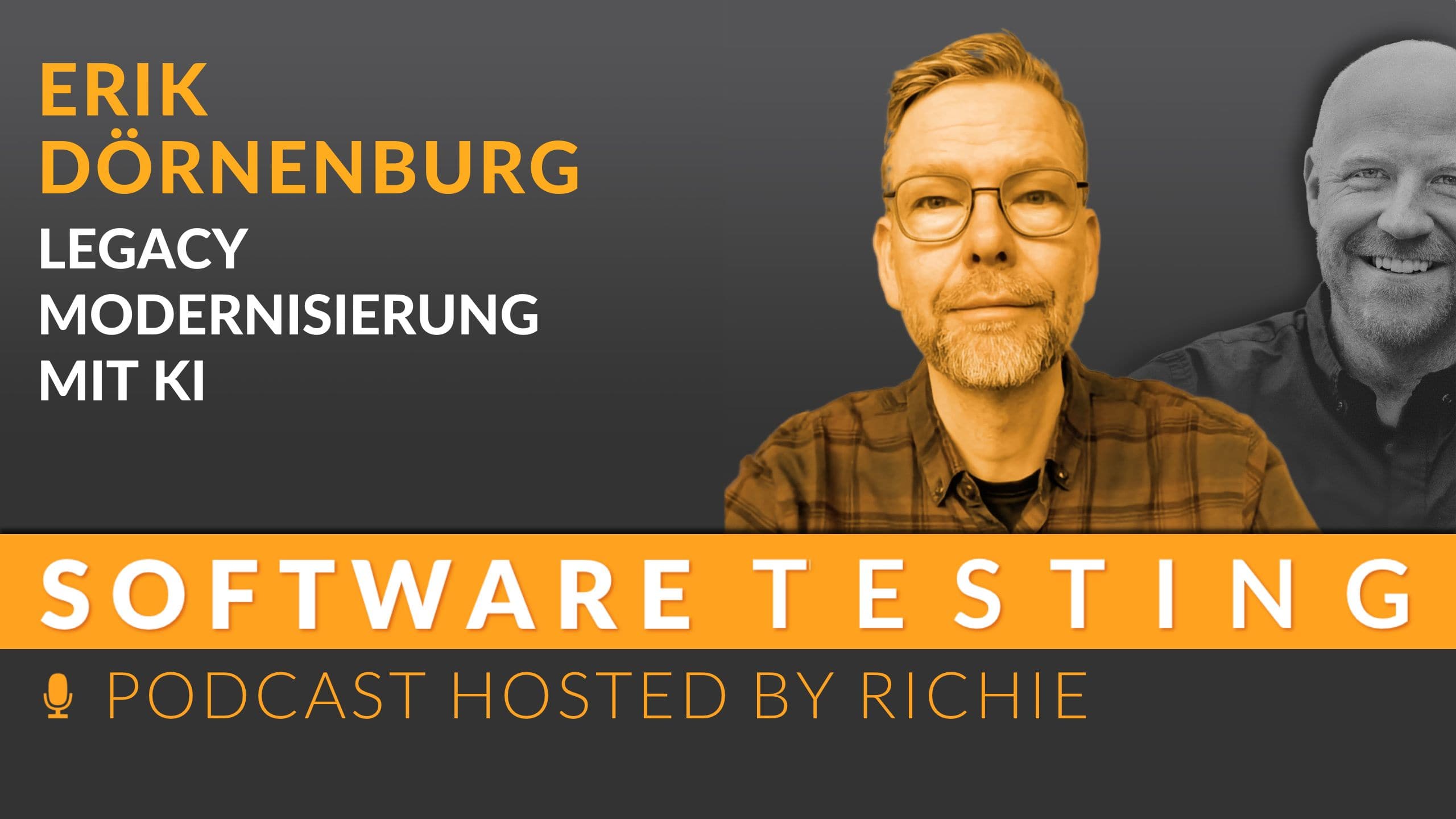
Legacy-Modernisierung ist eine Herausforderung. Viele Unternehmen stehen vor der Notwendigkeit, ihre veralteten Systeme - oft auf Mainframes oder in...

Die Software-Entwicklungs-Landschaft entwickelt sich sehr schnell. Das Zusammenspiel zwischen Technologie und dem menschlichen Element wird immer...